
Wissenschaft für alle: Das Studium Generale
Die Universität Konstanz vermittelt Wissenschaft an Universitätsangehörige und interessierte BürgerInnen.
Die Vorlesungen des Studium Generale finden jeweils montags um 18.45 Uhr im Hörsaal R 712 der Universität Konstanz statt.
Termine im Wintersemester 2024/25
Das Programm für das Studium Generale im Wintersemester 2024/2025 finden Sie demnächst hier.
Die Themen des Studium Generale im Wintersemester 2024/25
Eine Reihe von Vorträgen beleuchtet aktuelle Themen aus naturwissenschaftlicher, kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht. Fachleute aus unterschiedlichen Fachrichtungen erschließen Ihnen wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem neuesten Stand der Forschung.
Inhaltliches Konzept: Prof. Dr. Alexander Bürkle, Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Franke,
Prof. Dr. Beate Ochsner, Prof. Dr. Valentin Wittmann
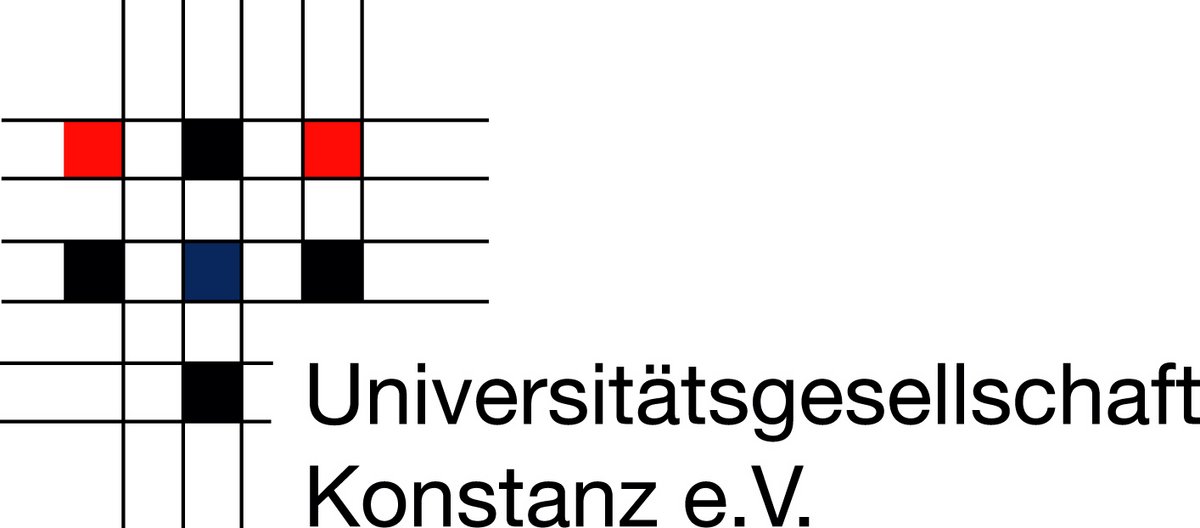
Mit Unterstützung und in Kooperation mit der Universitätsgesellschaft Konstanz sowie der Horst-Siebert-Lecture und den beiden Exzellenzclustern der Universität Konstanz "Centre for the Advanced Study of Collective Behaviour" und "The Politics of Inequality".
Bleiben Sie auf dem Laufenden – der E-Mail-Verteiler zum Studium Generale
Wenn Sie gerne über das aktuelle Programm des Studium Generale und kurzfristige Änderungen informiert werden möchten, können Sie sich hier bei unserem E-Mail-Verteiler registrieren.
Unterstützen Sie das Studium Generale!
Auch in Zukunft möchte die Universität Konstanz ein aktuelles und ausgesuchtes Veranstaltungsprogramm im Rahmen des Studium Generale kostenfrei anbieten. Die Umsetzung der Veranstaltung in einem hybriden Format verursacht jedoch zusätzliche Kosten durch den hohen Technikaufwand.
Wir freuen uns daher, wenn Sie das Studium Generale mit einer privaten Spende unterstützen.
Empfänger: Universität Konstanz
IBAN: DE92 6005 0101 7486 5012 74
BIC: SOLADEST
Kreditinstitut: BW-Bank Konstanz
Verwendungszweck: Studium Generale, Spende
